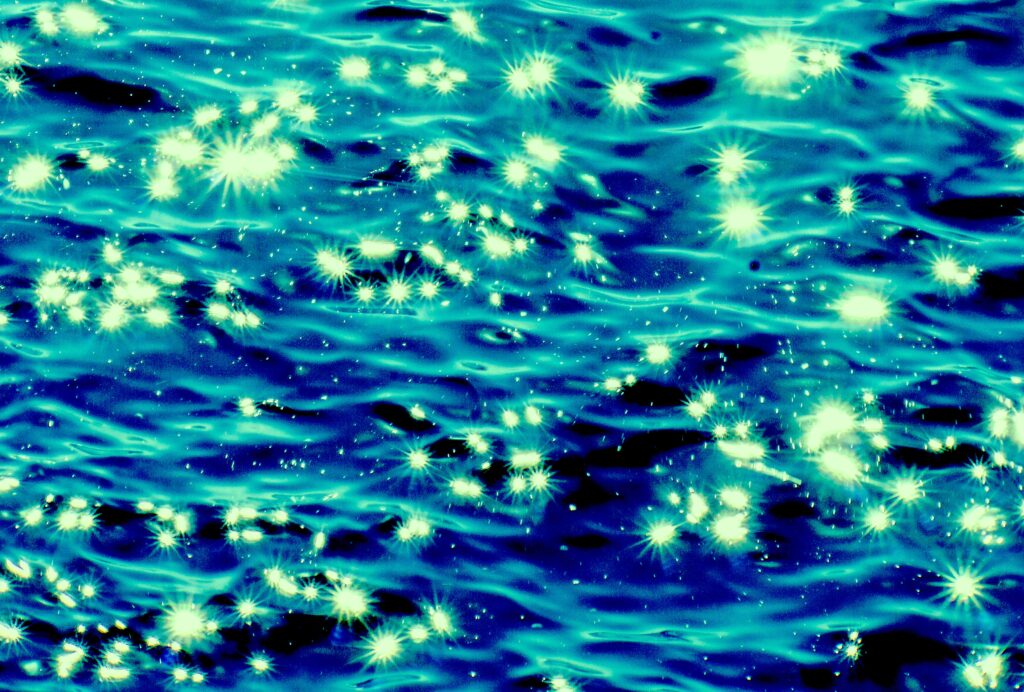
Dieser endlose Sommer. Endlos sonnige Tage, denen kurze milde Nächte folgen. Und wieder geht ein Tag zur Neige. Eine Handbreit überm Horizont gleißt die Sommersonne, verströmt sich vor zartem Himmelblau.
Einen schattenspendenden Arm an der Stirn, schaue ich ins flirrende Licht des Tales, das sich weithin unter mir ausbreitet: Diesige Luft lässt die grünen Höhenzüge ringsum ins Bläuliche verblassen. Wie Theaterkulissen, denke ich, was für ein stilles Schauspiel!
Wald, überall Wald, und nur einzelne Giebel lassen auf menschliche Anwesenheit schließen. Wahrscheinlich sah es hier vor Jahrhunderten schon genau so aus.
Irgendwie zeitlos.
Oft sitze ich hier oben, lasse den Blick schweifen und fühle mich dem Leben näher. So viel Wald, die Weite, nur wenige Menschen, dafür umso mehr Tiere.
Von der nahen Koppel her, höre ich Schnobern und Malmen. Der herbe Duft der Pferde weht heran.
Da, die Bussarde fliegen wieder. Lautlos kreisen sie über mir, majestätisch, scheinbar schwerelos getragen von der aufsteigenden Wärme. Hin und wieder ein schriller Ruf, unverkennbar ein Greif.
Einfach abheben, die Flügel ausbreiten, sich dem Nichts anvertrauen und – fliegen. Nur von der Luft getragen durch den Himmel gleiten… Wie sich das wohl anfühlen mag?
Ich breite die Arme aus und blinzel in die Helle der azurnen Weite über mir. Sekunden verstreichen, dann lache ich auf. Was bin ich für ein Kind! Als wenn ich fliegen könnte…
Matt lasse ich mich rückwärts sinken und schließe die Augen. Meine Hände fühlen warmes, trockenes Gras. Tiefes Einatmen. Es duftet nach Heuernte, süß und schwer. Mariengras. Johannisnacht.
Die unberührte sonnenwarme Wiese ist mir Bett und Halt, trägt mich weich und fest zugleich. Leises, vielstimmiges Sirren der Insektenwelt besänftigt alles Denken. Zur Ruhe kommen. Ausruhen dürfen. Sich gehen lassen, einen Schritt, dann noch einen, Abstand gewinnen von mir selbst. Beiseite treten, in eine andere Zeit, an einen anderen Ort. Ankommen dort.
Bläuliche Kringel wabern auf, steigen auf aus nachtdunkel schimmernden Weiten. Sehen mit geschlossenen Augen! Blitzblaue Funken sprenkeln sich hinein, verwischen zu funkelnden Schlieren. Schön – taucht ein Gedanke auf – diese Unterwasserwelt. Abtauchen, hineinschwimmen, sich treiben lassen.
Die See, die vielgeliebte, oft vermisste, schenkt sich mir in aller Vielfalt. Da treiben sie vorbei, die Meeresbewohner: winzige Seekühe, riesige Seepferdchen, grünblau sich wellende Wiesen aus Bänderalgen, allesamt im gleichen Rhythmus: langsam schwebend, ziellos, absichtslos.
Kühe, Pferde, Wiesen… Da war ich doch eben. Oder bin ich es noch? Ein Lächeln begleitet mein Verstehen: Erd- und Wasserwelten, wohl auch die des Himmels, sind sich so ähnlich, dasselbe, ja, vielleicht sogar das Eine. Das Einundalles.
Ein Seepferdchen gleitet näher jetzt; fast weiß ist es, nur überhaucht mit verwischten zarten Punkten. Eindringlich betrachten mich aufmerksame klarblaue Augen. Die Seitenflossen, zart und hoch wie Engelsflügel, wedeln unaufhörlich. Wie groß es ist! Ein richtiges Seepferd! Schon schwimmen meine Hände ihm entgegen und zutraulich schnobern seine Nüstern leicht darüber hin. Hauchzarte Berührungen kitzeln zärtlich meinen Arm entlang.
Nun neugierig äugend neigt es mir seinen schimmernden Kopf entgegen, beugt ihn seitwärts, nur ein wenig. Und da erblicke ich den Begleiter, seinen Reiter, wie mit ihm verwachsen, auf dem Pferderücken sitzt er. Sind sie Eines? Oder zwei? Ein Doppelwesen – Mensch und Tier? Staunend sehe ich helles langes Haar ein altersloses Gesicht umfließen, einen Körper, der geschmeidig das Gleichgewicht hält, ohne Sattel, ohne Zügel, verbunden nur durch Anmut und Verwandtschaft.
Schwimmen, schweben, gleiten, auf einander zu, umeinander her. Ich will mich sattsehen an diesem Wunderbaren, Zauberhaften. Mich anziehen, mitziehen lassen in Leichtigkeit und Harmonie, getragen von Wellen aus träumendem Nichts in bläulicher Färbung, aus indigodunklem Fühlen in aquamarinhelles Sein. Dasein, einfach nur dasein.
Und dann kommt sie zu mir, die ungeheure Weite, durchdringt mich, lässt alles Wünschen enden. Da sind Loslassen und Hingabe, und etwas weitet sich in mir, das Herz geht mir auf. Alle Dunkelheit entleert sich, entfließt mir, rinnt aus mir heraus, verblassend, vergehend im Wasserelement ringsum. Wie nie gewesen, ist sie fort.
Ein zeitloser Moment irritierender Leere.
Doch dann fühle ich das hereinströmende Glücksgefühl, mich unaufhaltsam flutend, bis ich ganz erfüllt bin und noch darüber hinaus, denn ich fließe über, ergieße mich in dieses Meer um mich herum, das unbegrenzt, ganz ohne Ufer scheint. Und werde so eins mit ihm. Ich werde zu all dem, zum Einen, das in allem ist.
Ich fühl’ mich an die Hand genommen, hingezogen, hochgehoben… und finde mich auf dem Seepferd sitzend wieder, leicht an seinen sonderbaren Reiter gelehnt.
Und auf geht es in geschmeidiger Bewegung, ein sachtes, schwebendes Ab und Auf. So beginnen wir, sich ausweitende Kreise zu ziehen, zu reisen. Vorbei an anderen Zwiegestalten, streifen wir durch wogende, dem Lichten über ihnen zustrebende Algenwälder, tauchen durch blauviolette Schwaden uns geschmeidig ausweichender Tentakelwesen, hinein in türkisgrüne schimmernde Luftblasenfelder, die aus unsichtbarer Tiefe nach oben streben.
Von überall her grüßen uns eindringlich wissende Blicke unbekannter Augen, gesandt von vorübergleitenden fremdartigen Wesen. Und mir will scheinen, ich sehe immer nur mich, als betrachte ich hier meine eigene Vielfalt, die, sich in und an mir spiegelnd, sich um mich herum bereitwillig zeigt.
So geht es schwebend, schwingend, kurvend eine endlos kurze selige Zeit.
Dann wandeln sich die Blautöne hin zu rötlichem Schein, und grazile Korallengebilde erscheinen in der Ferne. Mit Staunen sehe ich bizarre hellrote Formationen, geschmückt mit orange glühenden Leuchtbändern, die ihr Licht, Sonnenstrahlen gleich, in jede Richtung senden. Wie Abendrot, wie Morgenrot. Eine Fata Morgana der Tiefsee.
Sogleich geht es pfeilschnell darauf zu, und schon sind wir inmitten eines Leuchtfeuers nie geschauter Lebendigkeit. Geblendet muss ich die Augen schließen. Wir wirbeln herum, werden erfasst von Strömen aus purem Licht und nach einem Moment letzter unglaublicher Leichtigkeit, fühle ich wieder die allzu bekannte Schwere auf mich sinken. Jenes Gewicht, das meine Glieder fühlen, wenn ich dem Meer entsteige, nach Stunden ausgiebigen Schwimmens.
So finde ich mich liegend wieder, erwache sacht aus blau und roten Traumgebilden. Die Augen wieder öffnend, sehe ich blinzelnd gerade noch den letzten glühenden Sonnenbogen hinter den Hügeln versinken. Als Nachhall bleibt ein orangerotes Flammenmeer, durchzogen von liladunklen Wolkenbändern.
Ein Wiehern von der nahen Weide klingt zu mir, lässt meinen Blick hinüberwandern. Ein Schimmel reckt mir seinen Kopf entgegen, schaukelnd nickend, winkt er mir. Und neben ihm steht sein Begleiter. Ist es ein Reiter? Kein Zaumzeug hält er in den Händen, kein Sattel ist von hier zu sehn. Nur Wind spielt in rückgebundenem hellen Haar, das über seine Schulter fließt. Es findet mich ein Blick aus alterslosen Augen. Da ist ein Lächeln im wettergegerbten Gesicht, ein Mund, der freundlich zu mir spricht.
Das vorher unberührte Gras um mich herum ist leicht zertreten und Spuren führen fort, zur Koppel, kommt mir in den Sinn. So erhebe ich mich langsam und bin doch leicht benommen.
Dann schlendre ich zu beiden hin. Ich fühle mich willkommen.
***
2014

